- Newsletter
- Briefe
- Brief von Ralf Heimann
Das Wasserstoff-Dilemma | Kinderkliniken am Limit | Unbezahlte Werbung: Münster Cup

Guten Tag,
Nordrhein-Westfalen wäre gern ganz vorne dabei, wenn es um Klimaneutralität in der Industrie geht. Das Problem ist – wir kennen das aus Münster – der Weg dorthin. Eine Gruppe von Fachleuten und Organisationen aus dem Regierungsbezirk, die sogenannte „H2 Working Group“, hat sich Gedanken dazu gemacht, wie es gelingen kann, die Energiequelle Wasserstoff in der Region verfügbar zu machen.
Ein schönes Beispiel für eines der Hindernisse auf dem Weg steht auf Seite 17 des 25 Seiten langen Positionspapiers, das die Gruppe gestern veröffentlicht hat.
Es lautet: Wenn es keine Tankstellen gibt, kaufen die Leute keine mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeuge. Aber wenn die Leute keine mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeuge kaufen, baut niemand Tankstellen. „Beide Seiten warten aufeinander, und das macht den Start schwierig“, schreibt die Gruppe. Wie kriegt man das gelöst? Beziehungsweise: Warum will man das überhaupt?
Wasserstoff kann auf verschiedene Weise dabei helfen, Kohle, Öl oder Gas zu ersetzen. Beim Heizen zu Hause (Wärmeversorgung), beim Heizen auf der Autobahn (Mobilität) oder eben in der Industrie. Das Problem ist im Grunde überall, dass die Infrastruktur fehlt.
Der Mittelstand braucht einen Zugang zum überregionalen Wasserstoffnetz. Die bestehende Erdgasinfrastruktur wird weiter für Erdgas benötigt und steht daher nicht zur Verfügung. Und der größte Teil des Wasserstoffs muss importiert werden.
Man kann ihn auch selbst produzieren, aber dabei gibt es wieder ein anderes Problem. Wasserstoff fliegt nicht einfach in der Luft herum. Er hat sich in der Regel schon mit anderen Stoffen zusammengetan (im Wasser mit Sauerstoff, im Erdgas mit Kohlenstoff). Aus diesen Verbindungen muss er gelöst werden. Dazu braucht es Energie.
Verwendet man Kohleenergie, ist nicht viel gewonnen. Dann entsteht sogenannter grauer Wasserstoff. Klimafreundlich ist grüner Wasserstoff. Er wird mithilfe von erneuerbaren Energien produziert (es gibt auch noch andere Farben).
In ihrem Positionspapier schlägt die Gruppe Investitionen und weitere Förderprogramme vor, um zum Beispiel das Problem mit den Tankstellen zu lösen, dem Mittelstand den Zugang zu erleichtern und Wasserstoff zur Wärmeversorgung einsetzen zu können.
Teilweise gibt es solche Förderungen bereits. Die Westfälischen Nachrichten berichteten am Wochenende über das Amelsbürener Ziegelwerk Janinhoff, das 60 Millionen Euro aus Berlin bekommt, um auf grünen Wasserstoff umzusteigen.
Auch sonst passiert durchaus schon etwas: Die Bundesnetzagentur meldet heute die Genehmigung eines über 9.000 Kilometer langen Wasserstoffnetzes, das durch alle Bundesländer führt.
In Münster könnten die Stadtwerke ihr Kraftwerk am Hafen so umbauen, dass es mit Wasserstoff betrieben werden kann. Das Unternehmen hat allerdings andere Pläne. Es will heißes Wasser aus der Erde nutzen, um die Stadt klimafreundlich mit Wärme zu versorgen (Tiefengeothermie).
In den nächsten Wochen verteilen die Stadtwerke dazu unter anderem 36.000 orangefarbene Kästen in der Stadt, sogenannte Geophone. Sie hören in die Erde hinein, indem sie Schallwellen aus dem Untergrund auffangen. So findet man heraus, wie der Boden unter Münster beschaffen ist und ob man dort heißes Wasser findet. Morgen um 10 Uhr stellen die Stadtwerke ihre Pläne in einer Pressekonferenz vor. (rhe)
+++ Das Rathaus wurde schon wieder mit roter Farbe beschmiert. Dieses Mal haben es die fragwürdigen Künstler:innen allerdings nicht nur bei dem einen Gebäude belassen: Auch der Dom, das Asta-Gebäude am Schloss und das LWL-Museum in der Innenstadt wurden mit roten Klecksen und „Gaza“-Schriftzügen angemalt. Stadt und Polizei haben jetzt den Staatsschutz eingeschaltet, weil durch den Schriftzug der Verdacht eines politisch-extremistischen Motives besteht. Oberbürgermeister Markus Lewe verurteilt die Tat und betont die historische Bedeutung des Rathauses. Die Stadt überprüft jetzt eine Videoüberwachung am Rathaus. (ani)
+++ Katzenhalter:innen in Münster sollenihre freilaufenden Katzen nach einem Vorschlag der Stadtverwaltung in Zukunft kastrieren und kennzeichnen lassen. Die neue Verordnung soll „unkontrollierte Fortpflanzung“ und „sich unkontrolliert ausbreitende Infektionskrankheiten“ verhindern, heißt es in der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Das klingt ja fast so, als hätte Münster ein Problem mit zu vielen und kranken Katzen? Ganz so dramatisch scheint es aber nicht zu sein. Die ursprüngliche Forderung kam von der SPD und den Grünen. Sie begründen es auch mit überlasteten Tierheimen und Tierschutzorganisationen, die kaum noch hinterherkommen, alle streunenden Katzen zu kastrieren. Finanzielle Unterstützung wurde von Seiten der Stadt abgelehnt. Die durchschnittlichen 200 Euro pro Kastration (130 für Kater, 270 für Katzen) müssen die Tierschutzvereine also weiterhin selbst tragen – aber ab Dezember werden eben auch die Katzenhalter:innen in die Verantwortung genommen, wenn der Rat den Vorschlag am 12. Dezember so beschließt. Die Halter:innen wären dann für die Kontrolle und den Schutz ihrer Tiere verantwortlich. Verstöße würden zunächst nicht bestraft, könnten aber in Zukunft geahndet werden. (ani)
+++ Münster kann sich wieder mal selbst auf die Schulter klopfen. Bei einem bundesweiten Vergleich der Innenstädte beziehungsweise der attraktivsten Innenstädte, Tschuldigung, ist es diesmal Platz zehn geworden, meldet das Kommunikationsamt. Und gleich noch eine gute Nachricht hinterher: Wenn Sie irgendwo in der Stadt stehen und so begeistert sind von dem, was sich Ihnen da bietet, können Sie es inzwischen sogar gleich im Netz verbreiten, ohne ihre strapazierte mobile Datenverbindung zu belasten, denn wie die „Westfälischen Nachrichten“ berichten, haben die Stadt und die Volksbank an mehreren Stellen in der Stadt („Prinzipalmarkt, Domplatz, Stubengasse“) kostenfreies WLAN (#free.wifi.plus.vb-muensterland) installiert. Nanu, dabei ist es doch erst 2024. (rhe)

Hier finden Sie alle unsere Cartoons. Sollte Ihnen ein Cartoon besonders gut gefallen, teilen Sie ihn gerne!
Die Kinderbetten-Krise
Kinderintensivstationen sind seit Jahren überlastet. Vor allem während der Infektwellen im Winter. Es fehlt an Betten und an Personal. Constanze Busch hat für RUMS recherchiert, woran das liegt – und was das für Münster bedeutet.
Eigentlich müsste es auf der Kinderintensivstation der Uniklinik Münster in den Sommermonaten etwas ruhiger sein. 70 bis 80 Prozent Belegung: Dann bliebe genug Spielraum für die Infektwellen im Winter. Doch die Auslastung kommt regelmäßig schon im Sommer an ihre Grenzen.
Die Uniklinik ist die Anlaufstelle für Kinder, die wegen eines Schädel-Hirn-Traumas oder eines anderen schweren Notfalls behandelt oder künstlich beatmet werden müssen. So etwas können andere Krankenhäuser in Münster und oft auch im Münsterland nicht leisten.
Weil solche Notfälle aber nicht absehbar sind, muss die Klinik dann schnell umdisponieren. „Wir sagen 500 bis 1.000 stationäre Aufnahmen pro Jahr ab, weil wir durch Notfälle schon voll belegt sind“, sagt Heymut Omran, der Direktor der Pädiatrie an der Uniklinik.
„Dann müssen planbare Operationen verschoben werden.“ Besonders hoch sei der Druck während der Infektionswellen im Winter, wenn sehr viele Kinder etwa am RSV-Virus oder an Streptokokken erkrankten. Es gebe viel zu wenig Pflegekräfte für die Patient:innen, die betreut werden müssen.
Früher doppelt so viele Betten
Wie viel zusätzliches Personal es brauche, lässt sich laut Heymut Omran nicht beziffern. Aber ein Blick auf andere Zahlen zeigt, wie stark die Kapazitäten im Laufe der Zeit gesunken sind. Im Frühjahr konnten auf der Kinderintensivstation für größere Kinder (ohne die Station für Frühchen und Neugeborene, Anm. d. Red.) bis 13 Betten belegt werden, außerdem acht auf der Intermediate-Care-Station.
Die Intermediate-Care-Station nimmt Patient:innen auf, die eine intensivere Pflege und Betreuung brauchen, als eine Normalstation leisten kann. Da das ärztliche und Pflegepersonal an der Uniklinik so hochspezialisiert arbeitet, betreut es auf der Intermediate-Care-Station allerdings schwerere Fälle als andere Krankenhäuser auf ihren Intensivstationen.
Eine Pflegekraft, mit der wir gesprochen haben, sagte uns, vor rund zehn Jahren habe es auf der Kinderintensivstation 14 Bettplätze gegeben. Ursprünglich seien es sogar 17 gewesen, einer davon sei immer für Notfälle freigehalten worden.
Heute könnten im Schnitt zehn Patient:innen betreut werden. Manchmal seien es mehr, manchmal weniger – weil Personal fehle, aber auch, weil immer wieder Kinder mit bestimmten Infektionen isoliert und daher die übrigen Betten in ihren Zimmern gesperrt werden müssten. Auf der Intermediate-Care-Station habe es früher doppelt so viele Bettplätze gegeben wie heute.
Es kamen Kinder aus dem Ruhrgebiet
Am St.-Franziskus-Hospital ist diese Lücke kleiner, doch auch dort haben die Engpässe Folgen für die Patient:innen und Mitarbeitenden. 16 Intensivbetten für Früh- und Neugeborene und drei Intensivbetten für größere Kinder stehen im Plan. Aber nur zwölf bis 14 Betten auf der Intensivstation für Neugeborene und zwei Betten für größere Kinder können tatsächlich belegt werden.
Immerhin konnte die Klinik auch während der Infekt- und Grippewelle im Winter so viele Patient:innen versorgen wie in anderen Monaten. In der Hochphase der Infektwelle nahm sie sogar kranke Kinder aus dem Ruhrgebiet auf.
Aber das System stieß an seine Grenzen: Weil alle Betten belegt waren, musste das Franziskus-Hospital seine Kinderintensivstation zeitweise vom Rettungsdienst abmelden. Krankenwagen hätten dann keine erkrankten Kinder in die Klinik bringen können.
Sehr selten mussten auch hier planbare Operationen verschoben werden, weil auf der Intensivstation kein Platz für die Nachsorge frei war. „Für die betroffene Familie kann das tragisch sein, wenn etwa eine Wirbelsäulen-OP schon seit Monaten geplant ist und die Eltern sich Urlaub genommen haben, um ihr Kind zu betreuen“, sagt Meike Franssen, Chefärztin der Klinik für Neonatologie und Kinderintensivmedizin am Franziskus-Hospital.
„Wieder keine freien Intensivbetten“
Volle Auslastung schon im Sommer, große Engpässe im Winter: Das ist Alltag auf sehr vielen Kinderintensivstationen in ganz Deutschland. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) veröffentlicht seit Jahren in jedem Winter eine Pressemitteilung dazu, immer mit ähnlichen Texten über dieselben Schwierigkeiten: Der ohnehin bestehende Personalmangel verschärft sich während der Grippe- und RSV-Wellen, sodass viele Betten gar nicht belegt werden können.
Gleichzeitig erkranken sehr viele Kinder. Die Mitteilung von Februar 2024 heißt „Wieder keine freien Intensivbetten für kritisch kranke Kinder“. Im Dezember 2022 meldete die DIVI: „Aktuelle Klinik-Umfrage belegt: Durchschnittlich kein freies Intensivbett für kritisch kranke Kinder“.
Im Jahr 2018 zitierte eine Pressemitteilung einen DIVI-Vertreter: „Wir steuern seit Jahren offenen Auges auf dieses Problem zu und können nun in einem der reichsten Länder der Welt die flächendeckende Versorgung von kritisch kranken oder schwer verletzten Kindern nicht mehr sicher gewährleisten.“
Die Situation verbessert sich also nicht. Im Gegenteil, sie verschärft sich sogar. Im Jahr 2022 haben deutlich weniger Personen eine Ausbildung in der Pflege begonnen (zur Ausbildung unten mehr) – gleichzeitig gibt es aber mehr Kinder, die potenziell in Kliniken versorgt werden müssen.
Im Laufe der Jahre wurden außerdem Krankenhausbetten für Kinder abgebaut. Die Intensivstationen sind davon zwar weniger betroffen als andere Fachstationen. Ein Mangel an Betten, ganzen Stationen oder gar Kinderkliniken erhöht aber den Druck aufs Gesamtsystem.
Im Schnitt sieben Stellen unbesetzt
Dass Kliniken an Kinderstationen sparen, ist kein Zufall: Die Versorgung der jüngsten Patient:innen ist aufwändig und daher teuer. Für die Krankenhäuser bedeutet sie rein monetär ein Minusgeschäft, das andere Abteilungen finanziell auffangen und ausgleichen müssen.
Ein Team der Uni Köln hat das Problem 2019 in einer Studie untersucht. Die befragten Mitarbeiter:innen von Kinderkliniken und Fachabteilungen schildern dasselbe wie die DIVI: Die Versorgung kranker Kinder sei nicht mehr umfassend gewährleistet. Und zumindest 2019 wurde nach Aussage der Befragten nicht zuletzt an Personal gespart.
Doch auch für die Stellen, die noch in den Personalplänen stehen, fehlen Fachkräfte. Am Franziskus-Hospital sind im Schnitt sieben Stellen in der Kinderintensivpflege nicht besetzt. Es sei ein recht junges Team, schreibt die Klinik auf RUMS-Anfrage. Wegen Schwangerschaften oder Umzügen würden immer wieder Pflege- und ärztliche Stellen frei, die nicht sofort nachbesetzt werden können.
Die verbleibenden Mitarbeiter:innen müssen die Lücken auffangen – eine höhere Belastung als ohnehin schon. „Während der Krankheitswellen im Winter passiert es häufiger, dass Pflegekräfte für erkrankte Kolleg:innen einspringen müssen“, sagt Meike Franssen. „Dadurch wird viel Flexibilität von ihnen gefordert, was natürlich auch ihren Familienalltag schlechter planbar macht. Manchmal kündigen Fachkräfte, weil sie sich verlässliche Arbeitszeiten ohne Wochenend-Dienste wünschen.“
Stellen nachzubesetzen, sei immer schwierig. „Wir brauchen sehr spezialisierte Pflegekräfte, die sehr gefragt und deshalb fast nie arbeitslos sind. Wir können also nicht einfach Stellen ausschreiben und bekommen dann Bewerbungen“, erklärt Meike Franssen. „Wir müssen darauf warten, dass neue Fachkräfte ihr Examen ablegen oder beispielsweise Pflegekräfte aus der Elternzeit zurückkommen.“
Arbeitsdruck, Belastung, Teilzeit
Wie groß der Fachkräftemangel in der Pflege tatsächlich ist, lässt sich schwer beziffern. In einer von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie war schon im Jahr 2018 die Rede von mehr als 100.000 fehlenden Vollzeitkräften.
Wir haben mit Pflegekräften der Kinderintensivstation an der Uniklinik darüber gesprochen, warum das so ist. Sie sagten uns, seit ein paar Jahren reduzierten gerade jüngere Kolleg:innen, die noch nicht lange im Beruf sind, ihre Stunden und arbeiteten nur noch in Teilzeit.
Einige von ihnen fühlten sich überlastet, weil sie viele Überstunden machen und auf Pausen verzichten müssten. Manche könnten sich nach der Arbeit nicht erholen und kämen dann mit Bauchschmerzen wieder zum Dienst.
Dazu komme die seelische Belastung durch viele Schicksalsschläge, die das Pflegepersonal miterlebe: Die Kinder seien eben sehr krank, manchmal erlebten die Pflegekräfte auch mit, dass junge Patient:innen sterben.
Außerdem hätten die Pfleger:innen schon direkt nach dem Einarbeiten mit sehr schweren Fällen zu tun – einfach weil die Uniklinik wegen der geringeren Kapazitäten vor allem sehr kranke Kinder versorge und oft gar keinen Platz für weniger schwere Fälle habe. Wie in anderen Berufen und Branchen sei außerdem die Work-Life-Balance ein immer wichtigeres Thema.
Mit dem Wunsch nach Teilzeit sind die jungen Nachwuchskräfte in guter Gesellschaft: In Nordrhein-Westfalen arbeitet gut die Hälfte des Pflegepersonals in Krankenhäusern nicht in Vollzeit. Deutschlandweit sieht es ähnlich aus, und viele Fachkräfte haben den Beruf längst verlassen. Unter anderen Bedingungen würden viele von ihnen laut einer Studie aber wieder zurückkommen oder ihre Stunden wieder aufstocken.
„Wie lange kann man so arbeiten?“
Doch diese besseren Arbeitsbedingungen müssten ja erst einmal geschaffen werden. Es ist ein Teufelskreis: Je größer der Mangel, desto höher die Arbeitsbelastung auf den Stationen. Es gebe Phasen, in denen man acht Stunden nur am Bett stehe, manchmal sogar zu zweit, weil es bei einem Patienten oder einer Patientin eine Notfallsituation nach der anderen gebe, sagt eine Pflegekraft der Kinderintensivstation an der Uniklinik. Dann seien keine Pausen möglich.
Gleichzeitig müssen die anderen Pflegekräfte mehr Patient:innen versorgen als vorgesehen, weil die beiden Kräfte, die den Notfallpatienten betreuen, anderswo fehlen. Und fast immer müssen die Pflegekräfte Aufgaben an die Kolleg:innen der nächsten Schicht weitergeben.
Betten frisch beziehen und die Patient:innen währenddessen umlagern, patienten- und behandlungsspezifisches Material auffüllen: Diese Tätigkeiten müssen Fachkräfte übernehmen, die die Patient:innen und den Behandlungsplan genau kennen. Doch wenn es eng ist, können und müssen solche Aufgaben eben aufgeschoben werden.
Dieser ständige Mangelzustand macht viele Pflegekräfte unzufrieden, gerade wenn sie ihren Beruf lieben und trotz aller Schwierigkeiten voller Überzeugung ausüben. Es gebe so tolle Dienste, wenn es zum Beispiel Patient:innen besser gehe und man von Angehörigen viel zurückbekomme, sagt uns eine Pflegekraft.
Aber es gebe eben auch die Tage, an denen man drei statt planmäßig zwei Patient:innen versorgen müsse und ihnen dann nicht gerecht werden könne. Dazu kämen der Schichtdienst und Dienste an jedem zweiten Wochenende, man verpasse Familienfeiern und andere private Einladungen: „Wie lange kann man so arbeiten?“
Neue Ausbildung hat ein Problem
Dass bald ausreichend junge Pflegekräfte nachrücken, ist laut Meike Franssen und Heymut Omran durch eine Veränderung der Pflegeausbildung allerdings noch unwahrscheinlicher geworden.
Seit 2020 gibt es die Ausbildung „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ nicht mehr. Sie ist in der sogenannten generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft aufgegangen, die die Auszubildenden darauf vorbereiten soll, Menschen aller Altersgruppen zu pflegen.
Zwar können die angehenden Pflegekräfte im dritten Lehrjahr den Schwerpunkt Pädiatrie wählen. Das sei aber nicht vergleichbar mit der früheren Ausbildung in der Kinderkrankenpflege, sagt Heymut Omran. Um dieses Fachwissen und die Erfahrungen zu erwerben, müssten die Pflegekräfte sich nach der Ausbildung noch weiterbilden.
„Wir bauen dazu zwar jetzt ein Programm auf, aber nur wenige Menschen entscheiden sich dafür, nach der Ausbildung noch weiterzulernen“, sagt Omran. Das Ziel der neuen Ausbildungsstruktur sei gewesen, mehr Krankenpfleger:innen zu bekommen. Dadurch entstünden jetzt aber Probleme in der Kinderkrankenpflege.
Aus Sicht der Pflegekräfte gibt es noch ein Problem mit der neuen Ausbildung: Die Kinderintensivstation ist kein Pflichtteil, sondern ein sogenannter Wunscheinsatz. Und sie dauert nur wenige Wochen statt wie in anderen Klinikabteilungen mehrere Monate. In dieser kurzen Zeit bekämen die Auszubildenden gar keinen richtigen Einblick. Es sei viel schwieriger als vorher, sie für diesen Bereich zu begeistern.
Kann eine Impfung helfen?
Wenn der Mangel so groß ist, können Kinder auf den Intensivstationen überhaupt noch ausreichend gut versorgt werden? Michael Sasse, der Leitende Oberarzt der Kinderintensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover, gab Ende 2022 – mitten in der damaligen RSV-Welle – eine drastische Antwort: „Die Situation ist so prekär, dass man wirklich sagen muss: Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können.“
Die Aussage stimme nicht pauschal für die Kinderintensiv-Versorgung, sagt Heymut Omran: „Wenn Notfälle bei uns ankommen, versorgen wir sie, so wie jede Klinik.“ Aber es sei möglich, dass etwa ein Patient aus einer kleineren Klinik in eine Spezialklinik verlegt werden müsste, diese Kliniken aber keine Kapazitäten haben.
„Dann wird dieser Patient zu diesem Zeitpunkt leider nicht mehr optimal versorgt“, sagt Omran. Er und sein Team müssten in solchen Fällen abwägen: „Wir möchten natürlich helfen. Aber wenn wir jemanden aufnehmen, für den wir keine Kapazitäten haben, wäre der Patient ja auch bei uns nicht gut versorgt.“
Was ließe sich noch gegen die Engpässe in der Intensivversorgung tun? Die DIVI machte in einer Pressemitteilung einen Vorschlag: Sie forderte die Ständige Impfkommission (STIKO) auf, die RSV- und die Grippe-Impfung für Kinder zu empfehlen.
Eine Grippe-Impfung ist bislang nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen empfohlen. Gegen das RSV-Virus können Babys und Kinder bisher nur passiv mit Antikörpern immunisiert werden (hier erklärt). Seit Juni empfiehlt die Ständige Impfkommission das für alle Neugeborenen und Säuglinge. Ein solcher Schutz wirkt sofort. Mit dem neuen Präparat Nirsevimab bleibt der Schutz über die gesamte RSV-Saison (Oktober bis März) bestehen. Im Gegensatz zu früheren Impfungen, die monatlich verabreicht werden mussten, ist bei dieser Immunisierung nur eine einzige Dosis erforderlich.
Die Uniklinik Münster wies in der vergangenen Woche in einer Pressemitteilung darauf hin, dass Eltern ihre Säuglinge ab sofort kostenlos impfen lassen können. Heymut Omran hofft, dass durch die Impfung eine „sehr schlimme RSV-Saison“ wie im vergangenen Jahr verhindert werden kann.
Auch die Ständige Impfkommission ist zuversichtlich: Sie geht davon aus, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte aufgrund von RSV-Erkrankungen durch die Impfung um etwa 80 Prozent sinken kann. Für die Kinderkliniken wäre das eine deutliche Entlastung.
Allerdings ist der Impfstoff laut dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland knapp. In Westfalen kann er zurzeit oft nur verschrieben, aber nicht verabreicht werden, wie das Westfalen-Blatt am Freitag berichtete. Möglicherweise werde in der kommenden Woche neuer Impfstoff in der Region ankommen. Aber ob es für alle 70.000 Babys in Westfalen-Lippe reichen wird, für die die Impfung empfohlen wird, ist offenbar ungewiss.
Eine App erspart Aufwand
Bisher hilft den Kliniken vor allem ein gutes Netzwerk. Seit ein paar Jahren gibt es eine App, in der Krankenhäuser ihre freien Betten eintragen können – das erspart manchen Anruf und zusätzlichen Aufwand. Die Kliniken in Münster und der Umgebung arbeiten auch regional eng zusammen, um Patient:innen bei Bedarf verlegen zu können.
Wenn die Uniklinik ein schwer krankes Kind von einer anderen Kinderklinik übernehme, werde es schnellstmöglich zur weiteren Behandlung wieder zurückverlegt, wenn das medizinisch vertretbar sei, erklärt Heymut Omran.
Das sei für die Kinder manchmal eine Belastung, vor allem aber emotional schwierig für die Eltern. Sie würden lieber in der Uniklinik bleiben, wo ihr Kind versorgt oder sogar gerettet worden sei. Manche hätten dann wenig Verständnis für die Verlegung. Aber es geht nicht anders.

Anonymer Briefkasten
Haben Sie eine Information für uns, von der Sie denken, sie sollte öffentlich werden? Und möchten Sie, dass sich nicht zurückverfolgen lässt, woher die Information stammt? Dann nutzen Sie unseren anonymen Briefkasten. Sie können uns über diesen Weg auch anonym Fotos oder Dokumente schicken.
+++ Preußen Münsters E-Sportlerinnen und E-Sportler treten heute Abend zum ersten Mal in der „Virtual Bundesliga“ an – gegen Eintracht Braunschweig. (Antenne Münster)
+++ Bis Ende nächster Woche dreht das ZDF in Münster zwei neue Wilsberg-Folgen. (Westfälische Nachrichten)
+++ Die Polizei hat am Samstag eine pro-palästinensische Demo, an der etwa 130 Menschen teilnahmen, aufgelöst, nachdem verbotene Parolen gerufen worden waren und ein Teilnehmer nicht an ein gegen ihn ausgesprochenes Redeverbot hielt. (Polizei Münster)
+++ Die junge Frau, die nach dem Verzehr giftiger Pilze in Lebensgefahr schwebte, hat eine Spenderleber erhalten, befindet sich aber weiterhin in einem kritischen Zustand. (WDR)
+++ Die Flüsse und Bäche in Münster sind ausnahmslos in einem „unbefriedigenden“ oder „schlechten“ ökologischen Zustand. (Antenne Münster)
+++ In Gremmendorf wehren sich die Gewerbetreibenden an der Einkaufsmeile gegen den geplanten Umbau, weil dadurch über 80 Parkplätze wegfallen sollen. (Westfälische Nachrichten)
++ Die erste Hälfte der Bundesstraße 51 bei Mauritz wird im November fertig sein, der Ausbau auf vier Spuren Ende nächsten Jahres, die Brücken und Lärmschutzwände im Frühjahr 2026. (Westfälische Nachrichten)
+++ Dass die Stimmung in der regionalen Wirtschaft sehr schlecht ist, zeigt inzwischen auch der Arbeitsmarkt. (IHK Nord-Westfalen)
+++ Das Landesmuseum am Domplatz hat einen vollständig erhaltenen Marienaltar aus der Werkstatt von Lucas Cranach dem Älteren erworben. (Landschaftsverband Westfalen-Lippe)
+++ Der Bau der neuen Wersebrücke an der Haskenau beginnt Mitte November, einen Monat später als ursprünglich geplant. (Stadt Münster)
+++ Weil der Aufzug defekt ist, kann eine 86-jährige Frau in Berg Fidel seit zwei Monaten nicht raus aus ihrer Wohnung. (Westfälische Nachrichten)
Wie gut kennen Sie sich eigentlich in und um Münster aus? Mit der App Münster Cup, die uns eine Leserin empfohlen hat, können Sie das ganz einfach herausfinden. Sie wählen eine der angezeigten Kategorien und raten los – wahlweise auch im Duell gegen andere Spieler:innen. Es gibt pro Frage vier verschiedene Antworten zur Auswahl. Haben Sie sich für eine Antwort entschieden, wird sofort angezeigt, ob Sie richtig liegen. Das kurzweilige Quiz gibt es kostenfrei im App Store von Apple und Android, eine kleine Einschränkung allerdings auch: Nach einer gewissen Spieldauer wird Werbung eingeblendet.
Hier finden Sie alle unsere Empfehlungen. Sollte Ihnen ein Tipp besonders gut gefallen, teilen Sie ihn gerne!
Heute hat Katja Angenent für Sie in den Terminkalender geschaut. Das sind ihre Empfehlungen:
+++ Heute Abend um 18 Uhr beginnt eine öffentliche Vorlesungsreihe, die sich mit den aktuellen Herausforderungen für Geschichtsorte auseinandersetzt. Denn die gesellschaftlichen Veränderungen des 21. Jahrhunderts machen naturgemäß auch vor Museen, Archiven und Gedenkstätten nicht halt. Heute spricht Professor Joachim Baur im Fürstenberghaus im Hörsaal F2 über „Geschichtsorte in der Migrationsgesellschaft“. Im weiteren Verlauf der Reihe geht es unter anderem um Auschwitz im 21. Jahrhundert, Geschichtsorte in den Niederlanden oder um das Kuratieren von Ausstellungen. Sämtliche Themen und Termine finden Sie an dieser Stelle.
+++ Und noch ein Tipp für alle, die spontan sind: Heute Abend um 20 Uhr liest Markus Kavka im Atlantic Hotel aus dem Buch „MTViva liebt Dich“, das er zusammen mit Elmar Giglinger geschrieben hat. Hier gibt es noch ein paar Restkarten.
+++ Am Mittwoch, 23. Oktober, gibt es zu einer eher ungewöhnlichen Zeit, nämlich um 16:45 Uhr, ein eher ungewöhnliches Format im Schlosstheater: PleiteJazz:Vision visualisieren heißt eine Filmvorführung mit Gespräch und Live-Musik, die rund einhundert Jahre umspannt. Die Veranstaltung ist eine Hommage an den flämischen Avantgardisten Paul van Ostaijen. Zu Wort kommen unter anderem eine Illustratorin und ein Biograph. Außerdem wird ein Stummfilm aus dem Jahr 2016 gezeigt, der auf Arbeiten von van Ostaijen beruht und gänzlich aus Archivmaterial zusammengesetzt wurde. Karten zu je acht Euro erhalten Sie hier.
+++ Ebenfalls am Mittwoch ist Naturfotograf Markus Mauthe in der Friedenskapelle zu Gast. Um 19 Uhr präsentiert er mit „Die Reise zum Klima“ ein fotografisches Portrait der Erde. Dabei konzentriert er sich vor allem auf Gegenden, die schon heute in besonderer Weise vom Klimawandel betroffen sind. Der Eintritt ist frei.
+++ Sich dem Phänomen Künstliche Intelligenz einmal vom wissenschaftlichen Standpunkt nähern können Sie, wenn Sie ab Donnerstag die „InterKI Talks“ an der Uni Münster besuchen. Den Auftakt der öffentlichen Ringvorlesung bestreitet der Philosophieprofessor Oliver Scholz um 18:15 Uhr mit der Frage: „Künstliche Intelligenz“ – Mogelpackung oder neue Kränkung der Menschheit? Alle Vorträge können auch per Zoom verfolgt werden. Hier gibt es die weiteren Themen und Termine.
+++ Kurzer Hinweis zum Vormerken: Im nächsten Jahr am 9. Mai kommt zum zweiten Mal der „S!NN-Kongress“ in die Halle Münsterland. Es geht um „Geschichten vom Gelingen“ – oder etwas technischer: um innovative Lösungsansätze für Herausforderungen in Umwelt und Gesellschaft. Tickets kosten so viel, wie man geben mag.
+++ Am Freitag und Samstag geht das „Runde Ecken“-Festival in die zweite Runde. Ab 19 Uhr spielen in der „Black Box“ im „Cuba“ an der Achtermannstraße Tintin Patrone, Andrew Pekler und das Jeff-Platz-Quartett. Am Samstag ab 19 Uhr sind die Bands „andres göring platz“ (mit RUMS-Mitgründer Marc Stefan Andres) und Bunte Luft zu sehen beziehungsweise zu hören, danach dann Kai Niggemann. Tickets kosten 15 Euro. Alles weitere hier.
Am Freitag schreibt Ihnen Anna Niere. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche!
Herzliche Grüße
Ralf Heimann
Mitarbeit: Constanze Busch (cbu), Jan Große Nobis (jgn), Anna Niere (ani), Katja Angenent (kan) – das bedeutet: Die einzelnen Texte im RUMS-Brief sind von der Person geschrieben, deren Kürzel am Ende steht.
Lektorat: Maria Schubarth
Diesen Brief teilen und RUMS weiterempfehlen
PS
Das ARD-Kurzfilm-Magazin „Unicato“ hat im September das „Literatur-Film-Festival“ in Münster besucht und unter anderem mit Festivalleiter Carsten Happe sowie den Filmemachern Christiaan Hümbs-Steinbeck und Romina Küper gesprochen. Falls Sie das Festival verpasst haben oder sich noch einmal daran erinnern möchten: Die Interviews und Kurzfilme stehen in der ARD-Mediathek und sind dort noch bis November zu finden.
Ihnen gefällt dieser Beitrag?
Wir haben Ihnen diesen Artikel kostenlos freigeschaltet. Doch das ist nur eine Ausnahme. Denn RUMS ist normalerweise kostenpflichtig (warum, lesen Sie hier).
Mit einem Abo bekommen Sie:
- 2x pro Woche unsere Briefe per E-Mail, dazu sonntags eine Kolumne von wechselnden Autor:innen
- vollen Zugriff auf alle Beiträge, Reportagen und Briefe auf der Website
- Zeit, sich alles in Ruhe anzuschauen: Die ersten 6 Monate zahlen Sie nur einen Euro.
Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie ab heute in der RUMS-Community begrüßen dürfen!

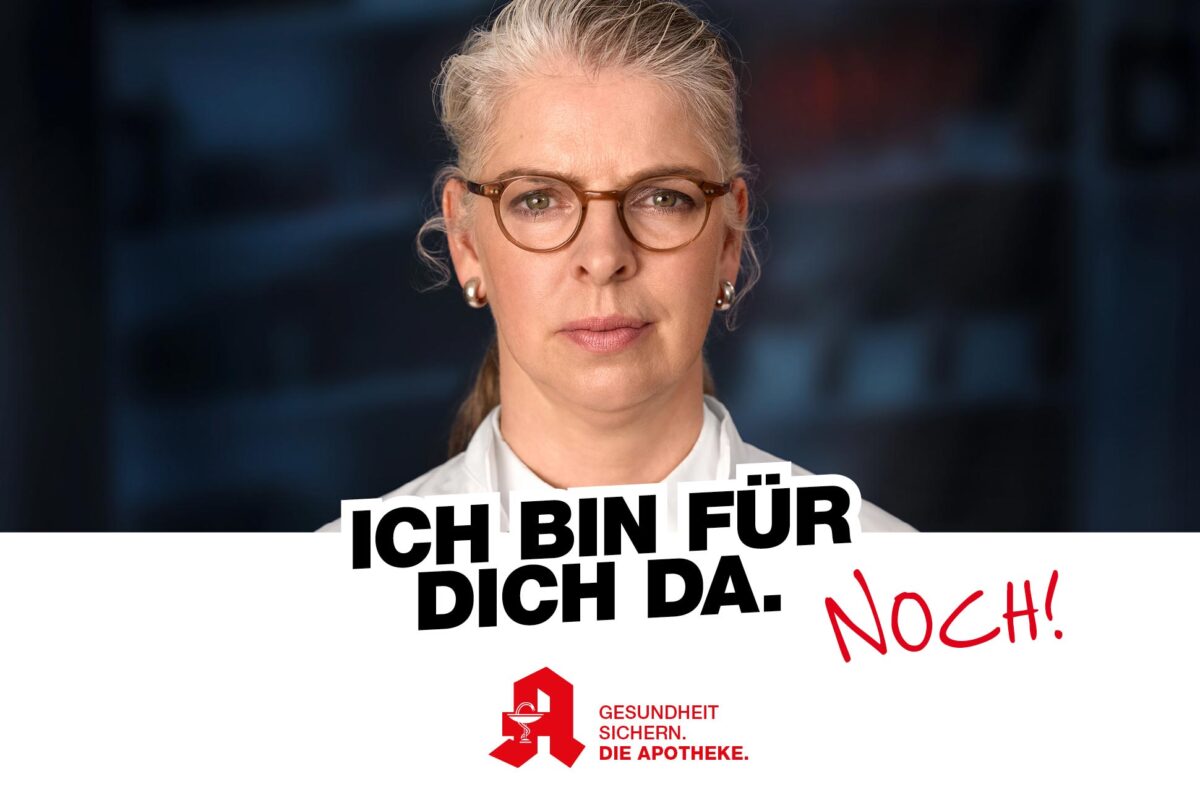
Sie möchten dieses Thema mit anderen Leser:innen diskutieren oder uns Hinweise geben
Nutzen Sie einfach unsere Kommentarfunktion unterhalb dieses Textes. Wenn Sie diesen Brief gerade als E-Mail lesen, klicken Sie auf den folgenden Link, um den Text auf unserer Website aufzurufen:
diesen Brief kommentieren